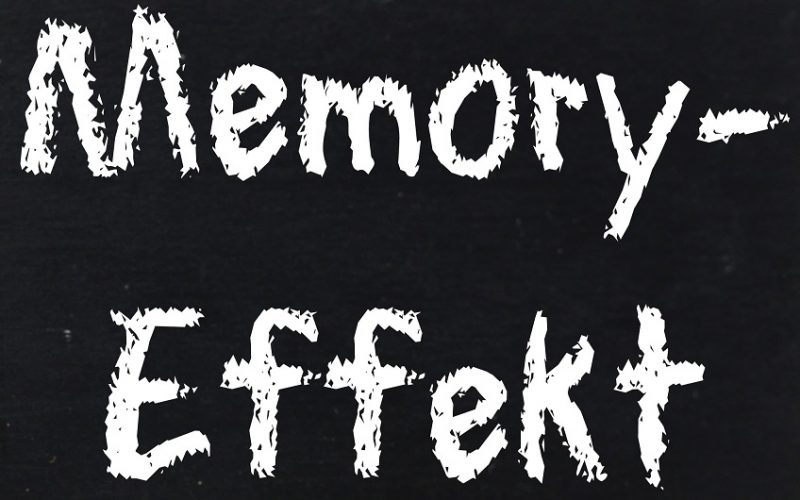Im Zusammenhang mit Akkumulatoren ist häufig vom sogenannten Memory-Effekt beziehungsweise vom Lazy-Battery-Effekt die Rede. Beide Effekte können in der Praxis für unangenehme Überraschungen sorgen, wenn die Leistungsfähigkeit einer Batterie plötzlich deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Vor allem Nutzer von Wohnmobilen oder Booten, die in hohem Maße auf zuverlässig funktionierende Versorgerbatterien angewiesen sind, sollten zumindest in Grundzügen über diese Effekte Bescheid wissen, damit sie deren Auftreten richtig erkennen und einordnen, vor allem aber auch rechtzeitig gegensteuern können.
Die Kapazität einer Batterie: erhebliche Unterschiede zwischen Theorie und Praxis
Das englische Wort „Memory“ lässt sich im Deutschen mit Erinnerung, Andenken oder Gedächtnis übersetzen, im technischen Sinne aber auch mit (Daten-)Speicher. Um zu verstehen, was genau mit dem Memory-Effekt bei Akkus gemeint ist, empfiehlt sich zunächst ein Blick auf deren grundlegende Funktionsprinzipien. Jeder Akku kann eine bestimmte Ladungsmenge speichern. Diese Ladungsmenge wird in Amperestunden (Ah) gemessen und als Kapazität bezeichnet. Je höher die Kapazität ist, umso mehr Energie kann der betreffende Akku bereitstellen, – allerdings nur theoretisch. Wie hoch die tatsächlich nutzbare Kapazität in der Praxis wirklich ist, hängt von mehreren Einflussfaktoren ab. Dazu gehören der Ladezustand, der Entladestrom, die Geräteabschaltspannung, die Anzahl der Ladezyklen und die Temperatur, aber auch die Lagerbedingungen und vor allem die Lagerzeit. Je nach Ausprägung dieser Faktoren können sich erhebliche Abweichungen zwischen der theoretisch möglichen und der tatsächlich zur Verfügung stehenden Kapazität eines Akkus ergeben.
Wie und woran kann sich eine Batterie „erinnern“?
Das heute allgemein als Memory-Effekt bezeichnete Phänomen wurde zum ersten Mal in den 1960er-Jahren von der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA beobachtet. Damals war im Zusammenhang mit Satellitenflügen aufgefallen, dass die an Bord von Satelliten verwendeten gesinterten Nickel-Kadmium-Batterien eine bis dahin unbekannte Reaktion zeigten. Die Akkus wurden während des Fluges regelmäßig von Solarzellen aufgeladen. Die Aufladung erfolgte immer dann, wenn die Solarzellen während des Fluges auf der Umlaufbahn um die Erde von der Sonne beschienen wurden, und zwar unabhängig davon, wie weit seit der letzten Aufladung bis zu diesem Zeitpunkt entladen worden waren. Im Laufe der Zeit registrierten die Wissenschaftler der NASA, dass sich die Batterien an diesen Laderhythmus anpassten. Ihre Kapazität nahm so weit ab, dass sie jeweils nur noch bis zum folgenden Ladezyklus reichte, obwohl die theoretische Kapazität deutlich höher lag. Die Batterien schienen sich also zu „erinnern“, in welchem Maß sie bei den vorherigen Ladezyklen aufgeladen worden waren. Die Ursache dafür wird in einer Bildung von größeren Kristallen beziehungsweise einer Umkristallisation an den negativen Elektroden in den Akkus vermutet. Diese Materialveränderungen führen zu einem Kapazitätsverlust und reduzieren somit die Leistungsfähigkeit des Akkus.
Wie sich „faule“ Batterien wieder auf Trab bringen lassen
Ein ähnlicher Effekt wie bei den klassischen Nickel-Kadmium-Akkus tritt auch bei Nickel-Metallhydrid-Batterien auf, allerdings nur in geringerem Maß. Da der Kapazitätsverlust nicht so ausgeprägt ist und die Nutzungsdauer der Ni-MH-Akkus sich nur etwas vermindert, wird hier von einem „Lazy-Battery-Effekt“ gesprochen. Die Batterie ist also weiter verwendbar, wird jedoch ein bisschen „faul“. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt sich das sogenannte „Zykeln“. Damit ist ein mehrfaches komplettes Auf- und Entladen des Akkus gemeint, wodurch dessen Leistungsfähigkeit wieder erhöht wird. Bewährt haben sich in diesem Zusammenhang Ladegeräte, die mit einer Entladefunktion ausgestattet sind. Besser ist es natürlich, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Deshalb sollten Nickel-Kadmium- oder Nickel-Metallhybrid-Akkus regelmäßig komplett entladen und danach wieder aufgeladen werden. Zu Vermeiden gilt es dagegen ein häufiges Aufladen, wenn die Batterie zuvor kaum oder nicht vollständig entladen wurde.
Copyright des Bildes: © Gerhard Seybert, adobestock, 118450097